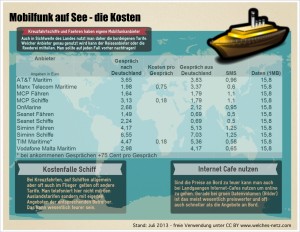Heute geht es ausnahmsweise mal nicht um den Kindle. Denn ich musste mal wieder zum Papierbuch greifen, weil es das Buch (ein Fachbuch) nicht als E-Book gab. Dabei wäre genau dieser Titel prädestiniert dafür…
Was mir dann beim Lesen aufgefallen ist, hat mich nachdenklich gemacht. Das Buch war in Kapitel gegliedert, soweit so gut. Innerhalb der Kapitel gab es dann aber so gut wie keine weiteren Gliederungsmerkmale. Lediglich Absätze hatten die Verfasser alle paar Zeilen mal großzügigerweise eingeschoben. Es gab keine weiteren Untergliederungen, Zwischenüberschriften oder Ähnliches. Das fand ich nach einer Weile ziemlich anstrengend. Ich vermute, ich bin da durch das Internet schlichtweg verdorben.
Versteht mich nicht falsch, ich lese gerne und auch lange Texte. Der jahrelange mehrstündige TV-Konsum in meiner Kindheit hat mir offenbar die Lust am Lesen nie genommen. Aber das beschränkt sich auf fiktionale Texte oder längere journalistische Stücke.
In einem Fachbuch will ich das Gleiche wie auf einer Webseite: Schnell die benötigten Informationen finden. Kein Mensch liest das Buch mehr von vorne bis hinten durch. Und banale Dinge wie Zwischenüberschriften würden ungemein helfen, das Wesentliche im Text zu entdecken.
Im Internet ist das zur Regel, wenn nicht gar zur Obsession geworden. Das Zauberwort heißt SEO. Denn dabei kommen Webseiten mit Zwischenüberschriften besser weg als solche ohne. Wenn ich im Internet etwas suche, will ich ja nicht erst eine lange Webseite durchscrollen, sondern sofort sehen, ob mir dieser Google-Treffer hilft. Jahrelanges Websurfen hat diese Scan-Technik perfektioniert. Ambitionierte Webseiten-Betreiber tun auch alles dafür, dass die Informationsaufnahme gut gelingt. Ansonsten ist die Webseite nämlich schneller wieder zu, als die Bannerwerbung wahrgenommen werden kann.
Man muss dazu sagen: Das Fachbuch war zehn Jahre alt. Aber ich habe sowohl in jüngeren als auch in älteren Fachbüchern Texte gelesen, die besser strukturiert waren. Genauso wie ich schon extrem unübersichtliche Webseiten gesehen habe – wie wahrscheinlich jeder von uns.